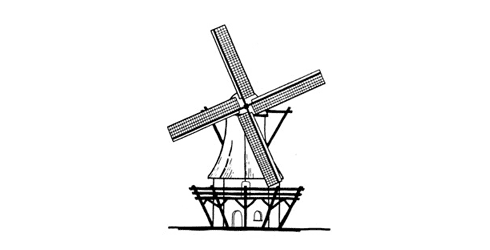Mühlenkunde
Technisch
Obwohl Mahlsteine bereits seit spätestens der Jungsteinzeit in Gebrauch sind, wurde das entscheidende Prinzip der Drehmühle – das Zerkleinern des Mahlgutes zwischen einem feststehenden Bodenstein und einem rotierenden Läuferstein – erst zwischen dem etwa 8. und 6. Jahrhundert v. Chr. erfunden.
Historisch
Auch wenn ihre Anfänge bislang nicht vollständig erforscht sind, sind Windmühlen zumindest ab dem 12. Jahrhundert in Flandern, Südostengland und der Normandie belegt. Von dort breiteten sich in ganz Europa aus und dominierten schließlich auch in Schleswig-Holstein das windreiche Küstenland zwischen den Meeren. Lange waren Landesherren, Klöster oder Städte die Besitzer der Mühlen, die sie verpachteten oder durch Verwalter führen ließen.
Der Mühlenzwang
Der Ursprung geht auf ein Gesetz von Friedrich Barbarossa aus dem Jahr 1158 zurück. Damit wurde den Grundherren das Mühlregal zugesichert, das alleinige Recht zum Bau und Betreiben einer Mühle. Alle Untertanen waren fortan verpflichtet, ihr Getreide ausschließlich in vorgeschriebenen Mühle mahlen zu lassen. Über Jahrhunderte wurden so den Müllern damit die Einkünfte gesichert. Verstöße wurden mit Strafen geahndet. Der Mühlenzwang hatte im deutschen Gebiet bis 1866 Bestand.
Die Blütezeit
Im Norden begannen sich die Holländermühlen im 18. Jahrhundert durchzusetzen und sollten von nun an für knapp 200 Jahre das Bild in Schleswig-Holstein bestimmen. Mit Aufhebung des Mühlenzwangs u. a. im Herzogtum Schleswig sowie in Holstein erlebten sie hier ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine regelrechte Blütezeit, weil sich dadurch Investitionen in den technischen Fortschritt endlich rechneten und das Wirtschaften leichter wurde. Allerdings sollte diese Zeit nicht von langer Dauer sein.
Die Elektrifizierung
Schließlich wurde 1957 das Mühlengesetz verabschiedet, das auch eine „Stilllegungsprämie“ gesetzlich verankerte, und so setzte ab Mitte des 20. Jahrhunderts das endgültige „Mühlensterben“ ein. Denn die Prämie bekam nur, wer nachweisen konnte, dass die Mühle nicht mehr produzieren konnte, so dass deshalb die meisten Mahleinrichtungen durch Demontage verloren gingen.
Die Sprache der Mühlen
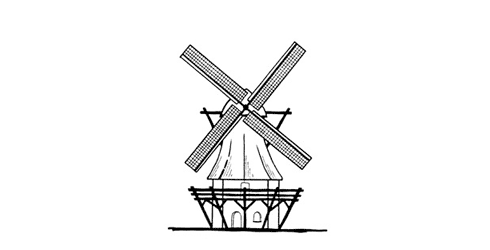
Kurze Pause
Im Winkel von 45° wurden die Flügel gestellt, wenn die Mühle kurzzeitig außer Betrieb war.
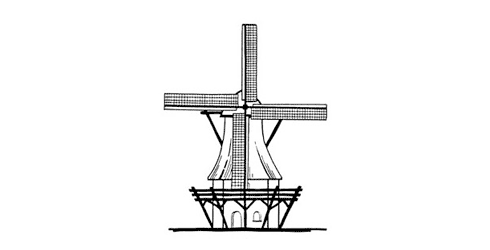
Lange Pause
Eine waage- und senkrechte Stellung steht für eine lange Pause. Das kann Feierabend beim Müller bedeuten oder auch, dass Zeit zum Schärfen der Steine benötigt wird.
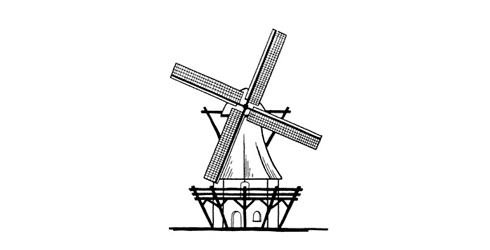
Freudenschere
Mit dem leichten Verdrehen im Uhrzeigersinn wurden freudige Ereignisse angezeigt, beispielsweise Hochzeiten, Geburten oder ähnliches.
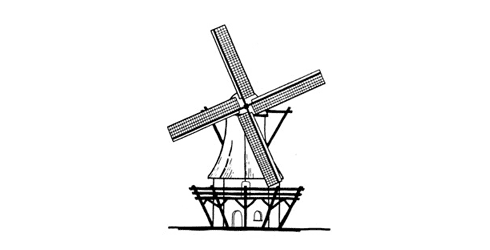
Trauerschere
Leicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht kann die Trauerschere auf Todesfälle oder ähnliches hinweisen.
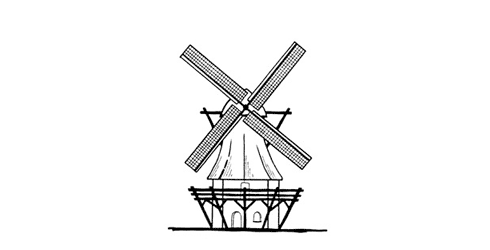
Kurze Pause
Im Winkel von 45° wurden die Flügel gestellt, wenn die Mühle kurzzeitig außer Betrieb war.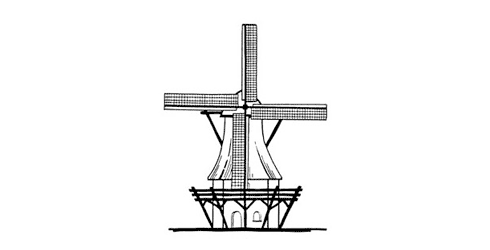
Lange Pause
Eine waage- und senkrechte Stellung steht für eine lange Pause. Das kann Feierabend beim Müller bedeuten oder auch, dass Zeit zum Schärfen der Steine benötigt wird.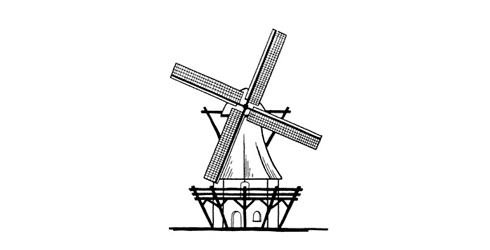
Freudenschere
Mit dem leichten Verdrehen im Uhrzeigersinn wurden freudige Ereignisse angezeigt, beispielsweise Hochzeiten, Geburten oder ähnliches.